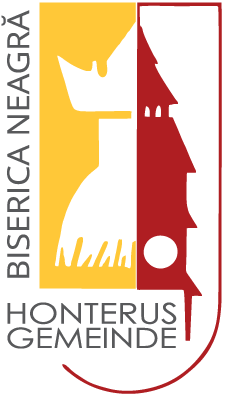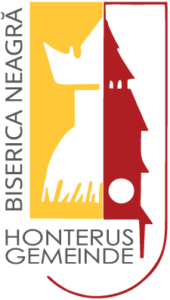Erntezeit
von Eduard Schullerus (1877-1914)
Kein Dengeln mehr, kein leises Sensensingen.
Die letzten Garben rauschen auf die Wagen;
Sie können kaum den schweren Segen tragen.
Aus frohem Dorf die Erntelieder klingen.
Erinnerung steigt aus längst versunknen Tagen,
Da lichtbesprüht im Abendglühn wir gingen,
Tief auf den Weg die goldenen Ähren hingen,
Und unsre Herzen hoch in Lust geschlagen.
Wie langsam einst der Flammenschein verglommen,
Wollt langsam nur dein Bild sich mir verklären
Mit Himmelsglanz. – Du warst ja dieser Erde!
Wann wird einmal der ernste Mäher kommen,
Dem ich, gebrochen, gleich den vollen Ähren,
Der Bürden müde, lächelnd folgen werde?
EROS UND THANATOS
von Prof. Dr. Carmen Elisabeth Puchianu
Erntezeit gehört zu meinen Lieblingstexten siebenbürgisch deutscher Dichtung, aus dem einfachen Grund, dass er zweifelsfrei zu den Großen der modernen Lyrik gerechnet werden kann und in nichts Sonetten des binnendeutschen Sprachraumes nachsteht. Im Folgenden soll auf einige seiner Besonderheiten hingewiesen werden in der Hoffnung, damit die Lust zum Lesen dieses und anderer Gedichte zu wecken.
Von Anfang an fallen einem bereits innere Spannung und emotionale Intensität der lyrischen Aussage auf, hier in deren anspruchsvollsten aller Formen, nämlich in der Form des deutschen Sonetts[1], die jedem Dichter sozusagen als ultimativer Prüfstein des Könnens gelten sollte. Und Eduard Schullerus stellt sein Können meisterlich unter Beweis, wie wir sehen werden.
Das Sonett setzt mit einer wiederholten Verneinung an, das heißt, die Aussage beginnt mit einem Schlussakkord oder setzt sogar einen Schlusspunkt: Die zwei elliptischen Hälften der ersten Zeile signalisieren durch ihren abgehackten Rhythmus einerseits einen Abbruch, nämlich jenen des Tagewerkes, des Tages selbst, und andererseits den Einbruch der Bewegungs- und Lautlosigkeit nach getaner Arbeit, wenn alles für einen kurzen Augenblick innehält, bevor das fröhliche Ernte- und Dankeslied ertönen kann. Eben dieser Augenblick verkörpert sich in der ersten Zeile, „Kein Dengeln mehr, kein Sensensingen”, wirkungsvoll vermittels substantivierter Verben mit betont auditivem Charakter, die zwar Geräusche suggerieren, hier allerdings Ruhe und Stille aufkommen lassen. Die folgenden drei Zeilen bringen etwas Bewegung ins Bild, – auch dieses Mal sind es auditive Verben, „rauschen” und „singen”, die den Text beleben und der Aussage eine optimistische Wendung verleihen, der Reichtum der Ernte wird bestätigt, der Frohsinn der Menschen ist gerechtfertigt –, aber der Gesamteindruck vom Anfang bleibt bestehen.
Hält die erste Strophe eine Momentaufnahme fest, vergleichbar mit der Panoramaaufnahme einer Kamera, fokussiert die zweite Strophe auf ein subjektives Detail, bzw. wendet sich der Blick des lyrischen Betrachters aus der Gegenwart zurück in eine erlebte Vergangenheit, so als würde die Kamera einen weitentfernten Gegenstand heranziehen und vergrößern, um ihn so dem Betrachter deutlich zu machen. Es ist der Abendmoment, jenes Innehalten jeglicher Bewegung, der Erinnerung wachruft. Ein lyrisches Wir rückt in den Mittelpunkt, ein Liebespaar, das einander zugetan in romantischer Abendstunde in freier Natur zusammenkommt. Zeit und Raum geben Rahmen und Vorwand für das erinnerte und sehr persönliche Moment dieser vergangenen Liebesbegegnung ab. Die Metapher der Ernte, der reifen Ähren und des glühenden Abenddämmers erschließt sich dem Leser als durchaus zweideutig: Sie verweist einerseits auf Lebensfreude und Liebeslust, auf Glück und (ersehnte) erotische Erfüllung, andererseits verweist sie auf Vergänglichkeit und Virtualität der Erinnerung und des damit verbundenen Erlebnisses.
Sind die beiden Vierzeiler des Sonetts in beinahe sachlich distanziertem Ton formuliert, zeichnet sich der Diskurs der Terzinen durch einen betont subjektiven und rhetorischen Charakter aus, der auf erhöhte Emotionalität des lyrischen Sprechers hindeutet. Der erste der beiden Dreizeiler enthält eine Art Liebesklage in Form eines Ausrufs: Analog zu der zweimaligen Wiederholung von „kein” in der ersten Zeile des Gedichtes kommt das Wort „langsam” in Kombination mit „einst” und „nur” ebenfalls zweimal zum Einsatz, womit nicht nur das verzögerte Vergehen der Zeit angezeigt wird, sondern auch die Intensität des Erlebens und des Schmerzes verursacht durch den Verlust der Geliebten. Der Blick des Sprechers ist ebenso verklärt wie verschleiert, er ist nach rückwärts, bzw. ins eigene Innere gerichtet, die Gegenwart ist vollkommen ausgeblendet, sodass die letzte Strophe nur noch die Wunschvorstellung des lyrischen Sprechers als einzig mögliche Zukunftsvision offenbart.
Die Metaphorik dieser letzten Strophe knüpft an jene der ersten an, allerdings bezeichnen Ähren und Ernte nicht mehr Lebenselemente, sondern sie eignen dem Tod. Die rhetorische Frage in der Terzine drückt nicht nur den offensichtlich legitimen Todeswunsch des Sprechers aus, sondern sie verspricht am Ende des reichen Erntetages das versäumte Liebesglück. Eros kann sich nur mit Hilfe von Thanatos, dem ernsten aber offensichtlich sehr gnädigen Mäher, verwirklichen.
Erntezeit von Eduard Schullerus verdichtet in impressionistischer Manier das Zusammenspiel von objektiver und subjektiver Realität und veranschaulicht deren künstlerische Transformation in ein Artefakt, das letztendlich immer etwas für sich behält und sich der radikalen Entschlüsselung wiedersetzt so, wie es sich für ein gutes Gedicht gehört.
[1] Im Gegensatz zu dem Shakespeare-Sonett, das seine 14 Zeilen als kompakten Textcorpus mit deutlich abgesetztem finalen Couplet anordnet, besteht das deutsche Sonett aus zwei Vierzeilern und zwei Terzinen. Generell eignet dem Sonett eine strenge Dreierstruktur, bestehend aus These, Gegenthese und Synthese, wobei die beiden Vierzeiler einander antithetisch gegenüberstehen, während die Terzinen eine Auflösung der lyrischen Disputation herbeiführen.
 Prof. Dr. Carmen Elisabeth Puchianu,
Prof. Dr. Carmen Elisabeth Puchianu,
Transilvania-Universität,
Kronstadt